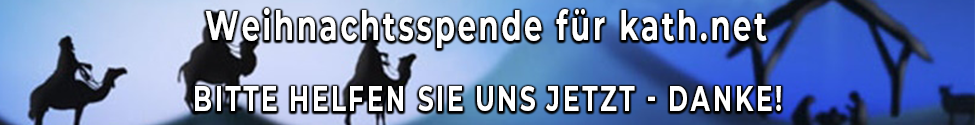 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||||||||||||||||||
              
| ||||||||||||||||||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Ein Durst, den kein Wasser stillt. Der Grund der Wirklichkeit4. August 2025 in Aktuelles, 2 Lesermeinungen Die Jugend und die Hoffnung auf Christus - über die Predigt von Papst Leo XIV. bei der Abschlussmesse der Heilig-Jahr-Feier der Jugend in Tor Vergata. Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) „Machen wir unseren Durst zu einem Schemel, auf den wir steigen, um wie Kinder auf Zehenspitzen durch das Fenster der Gottesbegegnung zu sehen“: Wer eine solche Sprache wagt, spricht nicht mehr nur als Lehrer, sondern als Liebender. Mit seiner Predigt zur Abschlussmesse der Heilig-Jahr-Feier der Jugend hat Papst Leo XIV. ein geistliches Dokument von mitnehmender Tiefe und kristalliner Schönheit vorgelegt. Keine bloße Ermahnung, keine moralpädagogische Rede oder gar sprachliche Anbiederung, sondern ein poetischer und theologischer Gang durch das Herz des Evangeliums, auf Augenhöhe mit einer Jugend, die sich nicht mit Oberflächlichem zufriedengibt, sondern mehr will: mehr Leben, mehr Wahrheit, mehr Liebe. Kurz: Gott. Diese Predigt enthält alle literarischen Anklänge, die große Sprache braucht, und zugleich eine Einfachheit von höchstem geistigen Rang. Sie überrascht durch ihre Tiefe, ihre Klarheit und ihre Schönheit, die nicht aus wohlfeilen Formeln, sondern aus der Wahrheit des Evangeliums selbst schöpft. Nichts an ihr ist floskelhaft, nichts bloß gesagt, weil es gesagt werden musste. Stattdessen: tragfähige, poetische, gegen den Strom gerichtete Botschaften, mit innerer Festigkeit und zärtlicher Zuwendung an die Jugendlichen gerichtet, gerade an jene, die in einer durchmedialisierten Welt am stärksten dem Verlust des Gedächtnisses und einem ideologischen Dauerbeschuss ausgesetzt sind. In einer Zeit, in der Orientierung selten geworden ist, öffnet diese Homilie den Raum für echte Begegnung: mit Christus, mit sich selbst und mit der Hoffnung, die nicht vergeht. Papst Leo wandte sich also an die „Lion Cubs“, die in der Nacht vorher im Schweigen vor dem allerheiligsten Sakrament des Altares aufgegangen waren: über eine Million junge Menschen, und das Schweigen und der „Schrei der Stille“ durchdrangen die Wirklichkeit der Kirche und der Welt. Die Struktur der Predigt ist kunstvoll komponiert. Vom Emmausgang (Lk 24) als Sinnbild der Sinnsuche junger Menschen über das Koheletwort zur Vergänglichkeit bis hin zur eucharistischen Freundschaft mit Christus entfaltet sich eine existentielle Dramaturgie: Der Mensch ist auf dem Weg, verunsichert und hungrig – doch die göttliche Gegenwart leuchtet auf, wenn das Brot gebrochen wird und das Herz zu brennen beginnt. Gleich zwei Leitbilder durchziehen die Homilie: Das eine stammt aus dem Psalter - das „Gras, das am Morgen wächst und am Abend verdorrt“ (Ps 90) -, das andere ist die „Wiese“, in der diese Zerbrechlichkeit nicht Zeichen des Verfalls, sondern des Wunders ist. In einem großen, fast mystischen Bild beschreibt der Papst die Lebendigkeit der Schöpfung: zart, vergänglich, sich selbst überlassend und gerade so fruchtbar. Das ist keine Naturromantik, sondern Schöpfungstheologie im Herzen der genuinen katholischen Tradition: Das Kleine birgt das Ganze. Die Zerbrechlichkeit ist nicht das Gegenteil des Lebens, sondern dessen Bedingung. Wenig überraschend, dass der heilige Augustinus in dieser Predigt ausführlich zu Wort kommt. Seine berühmten Worte aus den Bekenntnissen – „Du warst in meinem Inneren, und ich draußen“ – stehen im Zentrum einer Anthropologie der Sehnsucht. Gott ruft, leuchtet, berührt und der Mensch wird nicht eingeschüchtert, sondern entzündet. Dies ist also kein innerlicher Rückzug, sondern ein Ruf zum Aufbruch: Der Weg nach innen wird zum Weg nach oben. Und so ruft der Papst die jungen Menschen auf, „sich nicht mit weniger zufrieden zu geben“, sondern „nach Großem, nach Heiligkeit“ zu streben. Der Weg der Kirche ist nicht der kleinmütige Kompromiss, sondern die große Liebe. In den stillen und zugleich brennenden Passagen über den „Durst, den nichts auf dieser Welt stillen kann“, hören wir Blaise Pascal leise mitsprechen. Aber die Predigt bleibt nicht bei einer Analyse, sondern will einen Weg eröffnen. Der Durst wird nicht pathologisiert, sondern vergeistigt: als „Schemel“, als Schwelle zur Gottesbegegnung. Dies ist zutiefst christlich – und zutiefst tröstlich. Denn die Unruhe des Herzens ist nicht Zeichen eines Defizits, sondern Anzeichen der Berufung. Pastoral geschickt und theologisch fundiert verweist der Papst auf die Erfahrungen der Jugendlichen während der Heiligen Tage in Rom: Begegnung, Versöhnung, gemeinsame Suche. Doch diese Erfahrungen werden nicht romantisiert oder in das Gefängnis oberflächlicher Emotionen gesperrt, sondern in das Geheimnis der Kirche eingebettet: Nicht Besitz macht das Leben voll, sondern das, was man mit Freude empfängt und weitergibt. Die frohe Botschaft lautet: Der Mensch ist nicht gemacht für das Haben, sondern für das Schenken. Der wohl stärkste Satz der Predigt lautet schlicht: „Unsere Hoffnung ist Jesus“. Kein Prinzip, keine Methode, keine Strategie, sondern eine Person, wie dies bereits der heilige Johannes Paul II. und dann Benedikt XVI. in der Tiefe seiner Enzykliken „Deus Caritas est“ (2005) und „Spe salvi“ (2007) vorgelegt hatten. Und so erscheint Jesus, der Christus, nicht als dem verflachten Geist vielleicht zugängliches moralisches Vorbild (das deshalb unverbindlich bleibt), sondern als lebendiger Gefährte und Freund. Die Jugendlichen werden eingeladen, mit ihm in Freundschaft zu leben, konkret: durch Anbetung, Eucharistie, Beichte und Nächstenliebe. Dass dabei die beiden bald heiligzusprechenden Jugendlichen Piergiorgio Frassati und Carlo Acutis als Zeugen genannt werden, schließt den Kreis zwischen Vergangenheit und Gegenwart und setzt ein prophetisches Zeichen für die Zukunft. Die letzte Wendung zur Gottesmutter bringt noch einmal Tiefe und Milde zugleich. Maria erscheint nicht nur als Fürsprecherin, sondern als Weggefährtin in der Hoffnung. In einer Welt, die oft zersplittert und überfordert, wird die Gottesgebärerin zur stillen Lehrerin der Freude, die niet laut oder spektakulär ist, sondern gegenwärtig als Bild der Bilder. Nun denn: Diese Predigt, die der Löwe den „Lion Cubs“ mitgab, ist ein Schatz. Sie zeigt, wie eine zeitgemäße, theologisch durchdrungene und poetisch gesättigte Verkündigung aussehen kann. Sie spricht die Jugend nicht nur an, sie nimmt sie ernst und traut ihr etwas zu, weil Christus selbst ihr etwas zutraut. Papst Leo XIV. hat in dieser Homilie nicht nur eine pastorale Linie bekräftigt. Er hat ein geistliches Angebot gemacht: ein Christsein, das tief geht, verwandelt, herausfordert und gerade so heilt. Denn „die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen“ (Röm 5,5). Und das ist nicht nur ein irgendwie schöner und beruhigender Satz - das ist der Horizonte der Wirklichkeit.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  Lesermeinungen
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu |       Top-15meist-gelesen
| |||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||||||||||||||||||

