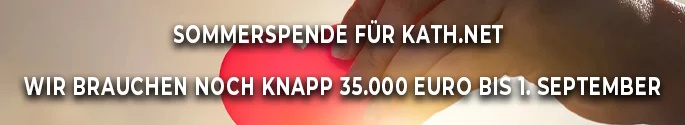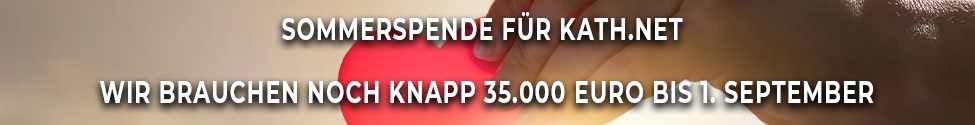 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Dem Leben dienen - nicht den Tod überlistenvor 2 Tagen in Aktuelles, keine Lesermeinung Die göttliche Liebe als Erbe: Papst Leo XIV. über das ewige Leben, den Willen Gottes und die tätige Nächstenliebe als höchste Lebensform. Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) Am 15. Sonntag im Jahreskreis hat Papst Leo XIV. zum Gebet des Angelus am Eingang des Apostolischen Palasts auf der Piazza della Libertà in Castel Gandolfo vor einer sehr großen und freudigen Schar von Gläubigen eine Katechese zum Evangelium des Tages (Lk 10,25-37) gehalten. Der Papst legte die Frage des Gesetzeslehrers „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?“ aus, eine Frage, die er als „Ausdruck eines beständigen Verlangens“ interpretierte: das Verlangen nach Erlösung. Die zentrale Figur der Katechese war nicht allein der Fragesteller aus dem Evangelium, sondern das, was Papst Leo als „ein Gut, das man erbt“ bezeichnete. Die Redeweise Jesu deutet laut dem Papst bereits an, dass das e Leben kein Produkt des menschlichen Handelns oder Wollens ist: „Es geht nicht darum, es mit Gewalt in Besitz zu nehmen, es wie ein Sklave zu erbetteln oder durch einen Vertrag zu erwerben“. Stattdessen: „Das ewige Leben, das nur Gott geben kann, wird dem Menschen als Erbe übergeben, wie von einem Vater an seinen Sohn. Diese theologische Grundstruktur - der Gedanke der Gabe, der väterlichen Herkunft und der kindlichen Annahme - bildete den roten Faden der Auslegung. Papst Leo XIV. verwies in der Folge auf die Antwort Jesu, der seinerseits den Gesetzestext zitiert: das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Die Liebe zu Gott „mit ganzem Herzen“, „mit ganzer Seele“, „mit all deiner Kraft“ (vgl. Dtn 6,5) und die Nächstenliebe „wie dich selbst“ (Lev 19,18) werden dabei nicht als moralische Forderung vorgestellt, sondern als Antwort auf die Liebe Gottes: „Der Wille Gottes ist jenes Gesetz des Lebens, das Gott uns gegenüber zuerst praktiziert, indem er uns mit seinem ganzen Sein in seinem Sohn Jesus liebt“. Diese Interpretation des göttlichen Willens als ein vorgängiges, heilendes Handeln Gottes rückt das christliche Leben in ein Licht, das weder aktivistische Leistung noch resignierte Passivität fördert, sondern auf die Entsprechung zur göttlichen Initiative zielt. Zentral war in der Katechese der Blick auf Jesus Christus selbst. Der Papst unterstrich: „Jesus ist die Offenbarung der wahren Liebe zu Gott und zum Menschen: einer Liebe, die sich verschenkt und nicht besitzt, einer Liebe, die vergibt und nicht fordert, einer Liebe, die hilft und niemals im Stich lässt“. Diese dreifache Beschreibung zeichnet die Struktur des göttlichen Handelns in der Welt und eröffnet zugleich das ethische Feld christlicher Existenz. Denn aus der Offenbarung Gottes in Christus folgt für Papst Leo ein Ruf zur Nachfolge: Der Mensch solle „demjenigen, dem er auf seinem Weg begegnet, zum Nächsten werden“. Diese Wendung - zum Nächsten werden - greift das Gleichnis vom barmherzigen Samariter auf, das dem Evangelientext folgt (Lk 10,29-37), auch wenn der Papst es nicht eigens zitierte. Die Nächstenliebe steht bei Leo XIV. nicht unter Vorbehalt, sondern ist nach dem Vorbild Christi zu leben. Die Bedeutung dieser Haltung umreißt er in einem entscheidenden Satz: „Um ewig zu leben, muss man also nicht den Tod überlisten, sondern dem Leben dienen, d. h. sich in der Zeitspanne, die wir miteinander verbringen, der Anderen annehmen. Das ist das oberste Gesetz, das allen gesellschaftlichen Regeln vorausgeht und ihnen Sinn verleiht“. Damit rückt der Papst das Thema „Ewiges Leben“ in ein besonderes Licht. Es ist nicht Flucht vor dem Tod, sondern Hineintreten in den Sinn der Zeit: die tätige Liebe, die der Anderen in ihrer Würde bejaht und trägt. In einem weiteren Schritt benennt der Papst die tätige Nächstenliebe als das „oberste Gesetz“, das über aller gesellschaftlichen Regelung steht: „Das ist das oberste Gesetz, das allen gesellschaftlichen Regeln vorausgeht und ihnen Sinn verleiht“. Diese Formulierung knüpft an eine lange Linie der katholischen Soziallehre an: das Naturrecht, verstanden als in das Herz des Menschen eingeschriebene Ordnung der Liebe. In Christus sei dieses Gesetz nicht abstrakt geblieben, sondern Fleisch geworden – eine These, die auch Augustinus bereits formulierte: „Lex Veritatis est ipse Christus“ (vgl. Tractatus in Iohannis Evangelium, 41,10). Leo XIV. Beschloss seine Betrachtungen mit einer marianischen Bitte. Maria, so der Papst, sei „Mutter der Barmherzigkeit“, und er bittet sie: „sie möge uns helfen, in unseren Herzen den Willen Gottes anzunehmen, der immer ein Wille der Liebe und des Heils ist, auf dass wir jeden Tag dem Frieden dienen können“. Dieser letzte Satz verweist auf die zentrale Intention des Pontifikats Leo XIV.: die Wiedergewinnung einer vom Evangelium geformten Lebensweise, die aus der stillen Kraft der göttlichen Liebe Frieden stiftet, nicht ideologisch, sondern durch konkrete Nähe zum Nächsten. Die Katechese des Papstes ist ein Beispiel für jene theologisch nüchterne, aber geistlich durchdrungene Sprache, in der Leo XIV. die großen Fragen des Glaubens mit den konkreten Herausforderungen des Lebens verbindet. Es ging ihm nicht um moralische Appelle, sondern um das Verständnis des Evangeliums als Einladung in ein Leben der Antwort – eine Antwort auf die Liebe Gottes, die in Christus Mensch geworden ist. Der Satz „Um ewig zu leben, muss man nicht den Tod überlisten, sondern dem Leben dienen“ kann als prägnante Zusammenfassung dieser Lehre stehen, und als Leitwort für eine Kirche, die in der Liebe Gottes zum Menschen ihren Ursprung und Auftrag erkennt.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu | 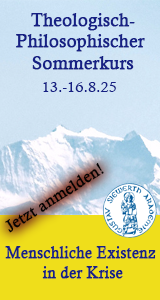      Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||