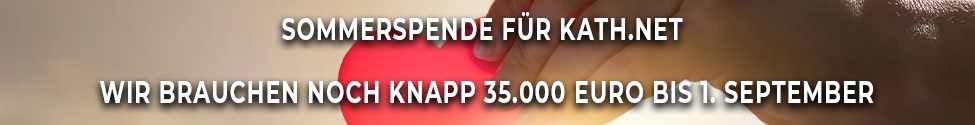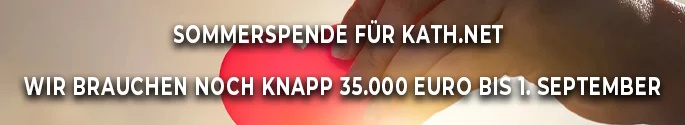SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln: 



Top-15meist-diskutiert- Bätzing fällt den Pro-Life-Bischöfen in den Rücken
- "In diesem Bistum möchte ich nicht mehr Priester sein!"
- Zählt Miersch/SPD den Bamberger Erzbischof Gössl ernsthaft dem „rechten Mob“ zu???
- Münchner Kardinal Marx: „Man kann kein Katholik sein und zugleich andere hassen“
- Liebes Bistum Bamberg, kommt jetzt Brosius-Gersdorf zum nächsten Marsch für das Leben?
- Wertfreie Werbung für Abtreibungen
- Bamberger Erzbischof Gössl wehrt sich gegen SPD-Angriff
- CSU-Chef Söder an die Linken: "Es ist nicht radikal, für christliche Werte einzutreten"
- „Brosius-Gersdorf hat schon alles gesagt“
- Legal töten?
- „Eine erneute Schande für die deutsche Kirche und wieder der BDKJ mittendrin“
- Theologe: Lateinamerikas Kirche verliert geistlichen Fokus, Glaubensthemen stets unberücksichtigt
- Bistum Fulda – stark engagiert beim ‚Christopher Street Day‘
- ‚Sag mir, wo die Kinder sind‘ – Abtreibung und Demographie: In Österreich fehlt jedes 3. Kind
- Kann ein Mensch eine Sache sein?
| 
Der Traum vom gemeinsamen Ostern – Chancen und Probleme1. Juli 2025 in Chronik, 19 Lesermeinungen
Druckansicht | Artikel versenden | Tippfehler melden
1700 Jahre nach Nizäa: Wie Christen heute das Osterfest gemeinsam feiern könnten - Die Problematik ist weniger theologischer als vielmehr kalendarischer Natur.
Von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer
Eichstätt (kath.net) Ein seltenes Ereignis fiel in diesem Jahr mit einem bedeutenden Jubiläum zusammen: 2025 feierten Christen weltweit am selben Tag das Osterfest und zugleich erinnern sie sich an das Erste Ökumenische Konzil von Nizäa im Jahr 325, dessen 1700. Jahrestag begangen wird. Das Konzil legte unter anderem die einheitliche Berechnung des Osterdatums fest, ein Vorhaben, das bis heute in der Praxis scheitert. Die Frage drängt sich auf: Ist es nicht an der Zeit, 1700 Jahre nach Nizäa das gemeinsame Osterfest Wirklichkeit werden zu lassen?
Der Ursprung: Einheit in der Vielfalt
Die Frage nach dem Osterdatum gehört zu den ältesten Streitpunkten in der Kirchengeschichte. Bereits im 2. Jahrhundert kam es zu Meinungsverschiedenheiten: Während man in Kleinasien und Palästina das Osterfest am 14. Nissan, dem jüdischen Passahfest, beging, betonten die Gemeinden in Rom und Alexandrien die Feier an einem Sonntag, unabhängig vom jüdischen Kalender. Diese Spannung zwischen jüdischer Wurzel und christlicher Eigenständigkeit mündete schließlich in das Konzil von Nizäa.
Das Konzil von 325, das als erstes ökumenisches Konzil der Christenheit gilt, war bestrebt, Einheit zu stiften, sowohl im Bekenntnis (mit dem Credo von Nizäa) als auch in der Praxis (etwa durch die Vereinheitlichung des Osterdatums). Die Konzilsväter einigten sich darauf, Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond zu feiern, ein Kompromiss zwischen östlicher und westlicher Tradition, der damals als große Einigung empfunden wurde.
Kalenderstreit als Kirchentrenner?
Mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders 1582 durch Papst Gregor XIII. verschärfte sich die Situation: Die katholischen und später auch die evangelischen Kirchen übernahmen den präziseren Sonnenkalender. Die orthodoxen Kirchen blieben hingegen, aus theologischen wie politischen Gründen, beim Julianischen Kalender oder führten modifizierte Berechnungssysteme ein. Die Folge: Bis heute feiern Ost- und Westkirchen Ostern meist an unterschiedlichen Terminen, obwohl beide die gleiche Regel von Nizäa anerkennen.
Die Problematik ist also weniger theologischer als vielmehr kalendarischer Natur. Und sie wird durch innerorthodoxe Spannungen noch verschärft: In der orthodoxen Welt besteht keine vollständige Einigkeit, wie mit dem Kalender umzugehen sei. Einige orthodoxe Kirchen (z. B. Griechenland, Rumänien, Bulgarien) haben den sogenannten revidierten Julianischen Kalender eingeführt, sie feiern Weihnachten also am 25. Dezember, halten aber für Ostern und alles, was damit zusammenhängt (von der Vorfastenzeit bis zum Allerheiligenfest, Sonntag nach Pfingsten) weiterhin am alten System fest. Andere, etwa die russische, serbische, jerusalemer und georgische Kirche, ebenso die altorientalisch-orthodoxen Kirchen (Kopten, Äthiopier, Syrer und Armenier) nutzen durchgehend den Julianischen Kalender. Dies und einige interorthodoxe politische Auseinandersetzungen erschweren bereits innerhalb der Orthodoxie eine Einigung über ein gemeinsames Festdatum, dazu kommt, dass ein ökumenisches Vorgehen mit Rom von einigen orthodoxen Hardlinern zusätzlich als erschwerend erachtet wird.
Ein ökumenischer Testfall
Ein gemeinsames Osterdatum wäre jedoch nicht nur ein längst fälliges Zeichen christlicher Einheit nach außen, es wäre auch ein geistlicher Fortschritt nach innen. In konfessionell gemischten Familien, ökumenischen Gemeinschaften, in Schulen und öffentlichen Feiertagen bringt die geteilte Osterfeier praktische Schwierigkeiten mit sich. Vor allem aber wird ein gemeinsames Osterfest immer mehr zum Prüfstein für den ökumenischen Ernst. 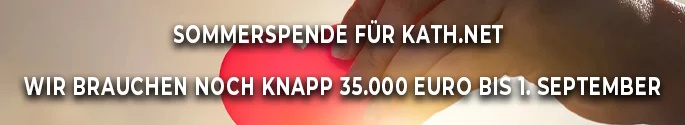
Schon 1920 schlug das Ökumenische Patriarchat in seiner bahnbrechenden Enzyklika „An alle Kirchen Christi überall“ vor, einen einheitlichen Kalender für die großen Feste zu etablieren. Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras I. griffen die Idee in den 1960er-Jahren erneut auf, ohne nachhaltigen Erfolg. Auch das Zweite Vatikanische Konzil bekundete in Sacrosanctum Concilium (Nr. 110) die Bereitschaft zu einem gemeinsamen Osterdatum. Und die Päpste Benedikt XVI., Franziskus und jetzt Leo XIV. sowie Patriarch Bartholomäus I. haben mehrfach signalisiert, dass sie zur Verständigung und einer gemeinsamen Lösung bereit wären.
Stimmen der Versöhnung – auch aus der Geschichte
Kirchengeschichtlich gab es bereits Vorbilder für eine solche Einigungsbereitschaft. Der heilige Papst Leo der Große etwa akzeptierte im Jahr 455 die Berechnung der alexandrinischen Kirche, obwohl das römische Osterdatum anders lautete. Statt auf Rom zu pochen, setzte Leo auf Konsultation, Demut und Einheit. Seine Bereitschaft zur Verständigung könnte auch heute als ökumenisches Vorbild dienen.
Die innerorthodoxe Debatte hat zuletzt 2016 auf dem „Heiligen und Großen Konzil“ von Kreta einen Rückschlag erlitten: Die Frage des gemeinsamen Osterfestes wurde zwar angesprochen, aber nicht entschieden. Zu stark waren die innerkirchlichen Vorbehalte, zu groß die Angst, die eigene Identität aufzugeben. Manche Kirchen sehen im Gregorianischen Kalender einen Ausdruck westlicher Dominanz und fürchten eine Preisgabe der eigenen Tradition.
Wege zur Lösung – Vorschläge für die Zukunft
Mehrfach wurde in den letzten Jahrzehnten versucht, die Osterfrage zu lösen. 1997 schlug eine internationale ökumenische Konsultation in Aleppo vor, das Osterdatum künftig auf wissenschaftlicher Basis zu berechnen – anhand exakter astronomischer Daten, ohne Rückgriff auf konfessionell geprägte Kalender. Rom signalisierte Zustimmung, die orthodoxe Seite blieb zögerlich.
Auch heuer (2025) ist wieder ein Anlass, solche Lösungen neu zu bedenken. Die 1700-Jahr-Feier von Nizäa bietet einen symbolträchtigen Moment. Es wäre der ideale Zeitpunkt für eine kirchliche Initiative, nicht als Schnellschuss, sondern als wohlüberlegte Verpflichtung zu einem schrittweisen ernsthaften Wandel.
Ein Vorschlag könnte sein, das Jahr 2025 als Ausgangspunkt zu definieren, um dann, etwa ab 2030, verbindlich ein gemeinsames Osterdatum einzuführen. Der Weg dahin müsste ökumenisch vorbereitet, innerkirchlich abgestimmt und pastoral gut begleitet werden. Ein solcher Prozess braucht Zeit, aber er ist bereits überfällig und duldet keinen Aufschub mehr.
Fazit: Zeichen setzen in einer zerrissenen Welt
Ein gemeinsames Osterfest ist mehr als eine technische Kalenderfrage. Es wäre ein geistliches und kirchenpolitisches Ereignis der Hoffnung in einer Zeit der Fragmentierung. Während in vielen Regionen der Welt Christen verfolgt, Kirchen zerstört und Gesellschaften polarisiert werden, wäre gerade ein gemeinsames Osterdatum ein leuchtendes Zeichen des Friedens, der Einheit und der Überwindung von Spaltungen.
Nicht aus politischer Strategie oder pragmatischem Kalkül, sondern weil der Glaube an die Auferstehung alle Christen verbindet und Ostern allen gehört. 1700 Jahre nach dem Konzil von Nizäa ist die Zeit gekommen, diesem Glauben auch gemeinsam Ausdruck vor der Welt zu verleihen.
„Die Auferstehung Christi darf nicht einseitig konfessionell vereinnahmt werden.“ (Grigorios Larentzakis)
Infos:
Die Osterregel von Nizäa (325):
Ostern soll am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn gefeiert werden.
Kalendersysteme heute:
- Julianischer Kalender: von Orthodoxen Kirchen verwendet
- Gregorianischer Kalender: weltweit Standard in Katholizismus und Protestantismus
- Revidierter Julianischer Kalender: Kompromisslösung in einigen orthodoxen Kirchen
Vorschläge zur Einigung:
- Aleppo-Dokument (1997): astronomische Berechnung ohne konfessionelle Bindung
- Nächster gemeinsamer Ostertermin nach 2025: 2038
Kurzbiographie von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer: geb. 1949 in Altdorf/ Titting;1977 Priesterweihe; 1977-1985 Abtei Niederaltaich; Studien (Diplom, Lizentiat, Doktorat): Eichstätt, Jerusalem, Griechenland, Rom; 1991-1998 Pfarrseelsorge; 1998-2008 Gründungsrektor des Collegium Orientale in Eichstätt; 2002 Erzpriester-Mitrophor; 2010 Archimandrit; 2004-2012 Päpstl. Konsultor für die Ostkirchen/Rom; 2008-2015 Rektor der Wallfahrt und des Tagungshauses Habsberg; 2011-2015 Umweltbeauftragter und 2014-2017 Flüchtlingsseelsorger der Diözese Eichstätt; seit 2017 Mitarbeit in der außerordentlichen Seelsorge.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

Lesermeinungen| | Triceratops 2. Juli 2025 | | | | Psalm1 Ja, stimmt natürlich. Aber ich war schon so konfus, weil ich 1. mein Posting aufteilen musste und dann ausgerechnet der erste Teil nicht übermittelt wurde, weil ich aus irgendeinem Grund ausgeloggt wurde, ohne das ich es rechtzeitig bemerkt habe. Beim zweiten Mal Schreiben ist mir dann dieser dumme Fehler passiert.
Danke fürs aufmerksam Machen. | 
0
| | | | | jabberwocky 2. Juli 2025 | |  | Liebe Foristen, danke an Sie alle für die Erläuterungen und hochinteressanten Einblicke in die ostkirchlichen Osterberechnungen. Diese kann man dann wohl zusammenfassen unter dem Satz: „Warum auch einfach, wenn es umständlich geht?“
Ich hatte nicht damit gerechnet, daß die Ostkirchen einen falschen Kalender und einen ebenfalls falschen babylonischen Metonzyklus verwenden, um den Ostertermin zu berechnen. Ich hatte zunächst nicht mal erwartet, daß sie den Termin berechnen, wo uns das Universum ja von alleine den Termin zeigt. Dann ist natürlich klar, daß es keine Einigung geben kann beim Ostertermin, wenn eine Seite der Gesprächspartner mit falschen Berechnungen daherkommt. Das bestätigt mich in meiner schon unten geäußerten Vermutung: Daß der orthodoxe Ostertermin primär eine Identitätsfrage zur Abgrenzung vom Westen ist und der julianische Kalender nur der Vorwand und das Vehikel dafür.
Auf jeden Fall habe ich jetzt das Problem verstanden, Danke nochmal an alle, die zur Lösung beigetragen haben! | 
0
| | | | | carola 2. Juli 2025 | | | | @ Psalm1 Ja genau so ist es. Alle hundert Jahre fällt der Schalttag sozusagen aus, außer das Jahrhundert ist durch 400 teilbar. 1900 gab es keinen Schalttag, aber 2000 gab es einen. Dass die Wochentage in den Kalendern nicht differieren liegt daran, dass bei der Einführung des gregorianischen Kalenders auf den Donnerstag den 4. Okt (alt) der Freitag der 15. Okt (neu) folgte. Das Grundproblem ist einfach, dass Tag, Mondumlauf und Jahr nicht einfach ineinanderpassen, sondern es hier immer "krumme Zahlen" gibt | 
1
| | | | | MiserereMeiDeus 2. Juli 2025 | | | | Ausführliche Erklärung der Gregorianischen Reform Ich kann jedem, der es genauer wissen möchte oder sich durch die vielen gutgemeinten Erläuterungen verwirrt fühlt, die verlinkte Ausarbeitung sehr ans Herz legen. www.nabkal.de/gregkal.html | 
1
| | | | | Psalm1 2. Juli 2025 | | | | @Triceratops "Deshalb wurde Ende des 16.Jh. der Gregorianische Kalender geschaffen, der festlegte, dass es dann, wenn die Jahreszahl durch 400 teilbar ist, keinen Schalttag geben soll."
Ist es nicht umgekehrt? Wenn die Jahreszahl durch 400 teilbar ist, wird ein Schalttag eingeführt. Bei allen anderen vollen Jahrhunderten nicht. Daher haben wir seit 1582 dreimal den Schalttag ausfallen lassen: 1700, 1800 und 1900. Zusammen mit den 10 Tagen aus dem November 1582 macht das eine Differenz von 13 Tagen zum Julianischen Kalender. | 
1
| | | | | carola 1. Juli 2025 | | | | @ Jabbberwocky Teil 2 Die Sache ist nämlich die, dass man den Frühlingsanfang auf den 21. März (bzw den 25. März9 festgelegt hat. daher kommt das ganze Problem. Ist bei uns bereits der 21. März also ungefähr Tagundnachtgleiche ist nach dem julianischen Kalender, erst der 8. März und eben noch nicht Frühling. | 
1
| | | | | carola 1. Juli 2025 | | | | @ jabberwocky die Wochentage in beiden Kalendern stimmen deshalb überein, weil ja einfach in beiden Kalendern immer weiter gezählt wird, Also das Jahr fängt nicht mit einem Sonntag an. Deshalb stimmen die Wochentage überein, nur die Daten ändern sich. Also heute ist nach dem julianischen Kalender erst der 18. Juni. Das Problem mit dem Vollmond ist folgendes: würde man einfach , wie Sie es vorschlagen zum Himmel gucken, feststellen. "O heute ist ja die erste Tag und Nachtgleiche, nach dem Winter! Und jetzt gucken wir wann danach der erste Vollmond ist und feiern dann Ostern!" bzw das ausrechnen, wäre das Problem aus der Welt. Dann wäre es der gleiche tag der nur in den jeweiligen Kalendern anders heißen würde. Das Problem wäre nur dann dass die Orthodoxie feststellen müssten dass ihr Kalender schon lange nicht mehr stimmt (auch der gregorianische stimmt auf Dauer nicht, in 3236 Jahren hat er einen Fehler von einem Tag) | 
1
| | | | | Triceratops 1. Juli 2025 | | | | @jabberwocky Teil 1 (nachgeholt wegen Verbindungsproblemen) Wenn ich nicht wüsste, worum es geht, hätte ich die Erklärung von @sciencia humana auch nicht verstanden (Meton-Zyklus und so). Also deshalb in anderen Worten:
Das Sonnenjahr dauert nicht genau 365 Tage, sondern um ca, einen Viertel Tag länger. Das hat man schon bei der Erstellung des Julianischen Kalenders gewusst. Deshalb hat man, um das auszugleichen, in jedem 4. Jahr einen Schalttag eingeschoben (29.2.) Im Laufe der Jahrhunderte hat sich aber herausgestellt, dass das etwas zu viele Schalttage waren. Deshalb wurde Ende des 16.Jh. der Gregorianische Kalender geschaffen, der festlegte, dass es dann, wenn die Jahreszahl durch 400 teilbar ist, keinen Schalttag geben soll.
Korrektur zu Teil 2, 1. Satz: Um den Fehler, der ... immer größer geworden ist, AUSZUGLEICHEN, hat man im Jahr 1582... | 
1
| | | | | scientia humana 1. Juli 2025 | | | | Werte Triceratops und jabberwocky (Teil III) Da also der julianische Fehler und der Metonfehler entgegen gerichtet sind, ist die Diskrepanz zwischen West- und Ostostern noch nicht so gross (wie der julianische Kalender vermuten ließe) und es dauert noch einmal ca. 4000 Jahre bis beide Osterfeste stets auseinander liegen. Wie gesagt dauert es ca. 45 000 Jahre bis Ostostern auf Weihnachten fällt. | 
1
| | | | | scientia humana 1. Juli 2025 | | | | Werte Triceratops und jabberwocky (Teil II) Damit wird es komplizierter: Wenn zwischen "Meton" und "julianisch" nur ein gregorianischer Wochentag liegt, dann ist Ostostern 35 Tage (wahrer Frühlingsvollmond Montag) oder 28 (sonst) Tage später. Wenn es 4 Wochentage (oder 3 von der anderen Seite her) sind, liegen die Osterfeste gleich (wahrer Frühlingsvollmond Sonntag bis Dienstag -- deswegen ist fast Halbmond zu Westostern und der steht morgens im Süden) oder sie sind um eine Woche (sonst) auseinander. | 
1
| | | | | scientia humana 1. Juli 2025 | | | | Werte Triceratops und jabberwocky (Teil I) Die Ostkirche hat zwei "Probleme" 1. den julianischen Kalender (13 Tage "falsch") und 2. den nicht mehr gültigen Metonzyklus zur Bestimmung des ersten Frühlingsvollmonds (9 Tage "falsch"). Den haben wohl die Babylonier entwickelt, um das Mondjahr mit dem Sonnenjahr zu harmonisieren: 19 Sonnenjahre entsprechen ziemlich genau 235 = 19*12 +7 Mondmonaten, d.h. in 19 Jahren werden 7 Schaltmonate eingefügt. Das ist auch der jüdische Kalender (der islamische hat dann die Schaltmonate verboten). Damit gibt es 19 mögliche Daten für den ersten Frühlingsvollmond (die werden periodisch immer durchlaufen, eigentlich ganz einfach) und die werden von der Ostkirche nach dem ca. zu Christi Geburt geltenden Metonsyklus berechnet (der etwa 200 Jahre gültig war). | 
1
| | | | | Triceratops 1. Juli 2025 | | | | @jabberwocky Teil2 (Ich weiß jetzt nicht, ob Teil1 verschickt worden ist, denn ich war plötzlich ausgeloggt)
Um den Fehler, der in den vergangenen eineinhalb Jahrtausenden immer größer geworden ist, hat man im Jahr 1582 auf den 4.10. direkt den 15.10. folgen lassen. Mittlerweile ist der Unterschied zwischen den beiden Kalender auf 13 Tage angewachsen. Wenn also der 21.3. ist, ist es laut Julianischem Kalender erst der 8.3. Für den Fall, dass der Frühlingsvollmond schon innerhalb den nächsten 13 Tage ist (also vor dem 21.3. nach Jul.Kal.), dann müssen die Orthodoxen auf den nächsten Vollmond warten. Ist er später, dann gilt der selbe Vollmond für beide Kalender. Da heuer der Vollmond erst am 13.4. war, sind die Ostertermine auf den selben Tag gefallen.Es gibt für die Orthodoxen noch eine Regel: Wird am fraglichen Sonntag noch Pessach gefeiert, dann muss Ostern um eine Woche verschoben werden. Im Westen ist es egal, ob noch Pessach ist oder nicht. | 
1
| | | | | jabberwocky 1. Juli 2025 | |  | Danke, werte(r) @scientia humana, für Ihre Erklärung Dann ist es also so, daß in der Ostkirche der julianische Kalender mitsamt seiner Abweichung über der aktuell getätigten Wahrnehmung steht, habe ich das so richtig verstanden? Denn wenn an TT.MM., nennen wir es heute, der wahre Frühlingsvollmond zu sehen ist, dann ist er ja nicht 9 Tage früher oder 21 Tage später zu sehen, sondern heute. Und am folgenden Sonntag wäre dann Ostern. Dann wäre aufgrund der Kalenderabweichungen das Datum ein anderes als bei uns (und sei es z.B. der 20.9.), aber das Osterfest selber am gleichen Tag. Denn im Grunde bräuchten wir ja überhaupt keinen Kalender zur Osterbestimmung. Wir schauen den Nachthimmel an, und wenn Frühlingsvollmond ist, dann ist am folgenden Sonntag Ostern.
Mir scheint es so zu sein, als ist der orthodoxe Ostertermin primär eine Identitätsfrage zur Abgrenzung vom Westen und der julianische Kalender nur der Vorwand und das Vehikel dafür, denn sonst macht eine solche Gedankenakrobatik keinen Sinn. | 
1
| | | | | MiserereMeiDeus 1. Juli 2025 | | | | Wahre Einheit geht nur ohne Stolz… und Respekt vor dem Konzil von Nizäa.
Daher wäre die bereits 1997 vorgeschlagene astronomische Lösung die einzige, die keine neuen Spaltungen bewirken müßte: die gregorianische Kalendarreform, die in Wirklichkeit sowohl den Sonnen- als auch den noch wichtigeren Mondzyklus an die wahren Verhältnisse angepaßt hat, war einfach „zu perfekt“.
Weil es eben derzeit kaum Osterparadoxien gibt, ist die Orthodoxie nicht bereit für den fälligen Schritt: es wäre das Eingeständnis, daß in Tom etwas herausragendes entstanden war/ist. | 
1
| | | | | scientia humana 1. Juli 2025 | | | | Lieber jabberwocky In der Tat, die Wochentage stimmen im gregorianischen mit denen im julianischen Kalender überein. Wenn an TT.MM der wahre erste Frühlingsvollmond ist, denkt die Ostkirche (nutzt einen nicht mehr aktuellen Metonzyklus), es sei 9 Tage früher (falls dann noch nach dem 21.3) oder 21 ( = 30-9) Tage später. Da der julianische Kalender aber aktuell 13 Tage in Wahrheit verspätet ist, ist der um 13-9 = 4 Wochentage oder um 21-13=8, d.h. einen Wochentag versetzt. Nun nimmt man den nächsten Sonntag und kommt auf das von mir angegebene Ergebnis. N.B. die Regel gilt bis 2099. | 
1
| | | | | scientia humana 1. Juli 2025 | | | | Lieber Fink Der gregorianische Kalender ist der astronomische (das war der Sinn der Kalenderreform unter Gregor XIII). | 
1
| | | | | Fink 1. Juli 2025 | | | | "Ostern soll am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn ...gefeiert werden."
Das ist doch eigentlich klar. Das Datum müsste von Astronomen (!) bestimmt werden, nicht von verschiedenen Kalendern !
Wie "jabberwocky" ist mir das Problem ein Rätsel. | 
1
| | | | | jabberwocky 1. Juli 2025 | |  | @alle, @Schlegl Also, irgendwie stehe ich auf der Leitung, denn ich verstehe das Problem nicht. Soviel ich weiß, sind in den Ländern, wo der julianische Kalender gilt, die Wochentage gleich wie hier. Wenn hier Sonntag ist, ist auch in Moskau oder in Bulgarien Sonntag (oder?) Und wenn hier Frühling ist, ist auch in Russland Frühling. Das heißt aber, daß der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond der gleiche Tag ist wie hier. Er hat nur ein anderes Datum. Na und?
Darum meine Frage: Feiert die Ostkirche Ostern an einem anderen Tag oder an einem anderen Datum?
Vielleicht gibt es hier jemanden, der mir das verständlich machen kann? Vielen Dank. | 
1
| | | | | scientia humana 1. Juli 2025 | | | | Sehr schöner Artikel Noch genauer: Der julianische Meteonzyklus der Ostkirche weicht ca. alle 130 Jahre um einen Tag vom wahren astronomischen Metonzyklus der Westkirche ab. D.h. z.Zt. gilt folgende Faustregel:
Ist Westostern spät und sieht man in der Osternacht den Mond im Süden (wunderbar heuer gesehen) so fallen Ost- und Westostern zusammen (= fällt der wahre Frühlingsvollmond um oder nach dem 30.3. auf einen Sonntag oder Montag). In ca. 4000 Jahren wird es kein gemeinsames Osterfest mehr geben und in ca. 45 Tsd Jahren ist Ostostern um Weihnacht. Vielleicht wird sich noch nicht einmal dann die Ostkirche bewegen. Der jüdische Kalendar hat sich bewegt und fügt Schaltmonate ein .... | 
2
| | |
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.
kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur, ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon gesprochen wird." (www.kath.net)
kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor, strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. | 
Mehr zu | 





Top-15meist-gelesen- "In diesem Bistum möchte ich nicht mehr Priester sein!"
- Bätzing fällt den Pro-Life-Bischöfen in den Rücken
- Zählt Miersch/SPD den Bamberger Erzbischof Gössl ernsthaft dem „rechten Mob“ zu???
- Sommerspende für kath.net - Eine Bitte an Ihre Großzügigkeit!
- Oktober 2025 mit kath.net in MEDJUGORJE mit P. Leo MAASBURG
- Liebes Bistum Bamberg, kommt jetzt Brosius-Gersdorf zum nächsten Marsch für das Leben?
- „Eine erneute Schande für die deutsche Kirche und wieder der BDKJ mittendrin“
- „Schon Brosius-Gersdorfs Doktorvater ist mit gleicher Einstellung zur Menschenwürde durchgefallen“
- Bamberger Erzbischof Gössl wehrt sich gegen SPD-Angriff
- Jenseits der Linien, im Gehege des Heiligen. Über einen Streit, der nicht sein darf
- „Brosius-Gersdorf hat schon alles gesagt“
- CSU-Chef Söder an die Linken: "Es ist nicht radikal, für christliche Werte einzutreten"
- Bistum Fulda – stark engagiert beim ‚Christopher Street Day‘
- Wertfreie Werbung für Abtreibungen
- Wer solche Freunde hat
|