 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||||||||||
              
| ||||||||||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Der Volkspapst – Was bleibt vom Franziskus-Pontifikat?25. April 2025 in Kommentar, 1 Lesermeinung „Wenn ich die letzten zwölf Jahre mit Papst Franziskus in diesen Tagen Revue passieren lasse, dann sind es die großen Gesten und Bilder, die unvergessen blieben und mich nachhaltig berührten.“ Reflexion von Michael Hesemann Vatikan (kath.net) Ich gebe zu: Es gab Phasen in seinem Pontifikat, in denen ich mit ihm gehadert habe. Sein Ja zur unkontrollierten Immigration, sein Glaube an einen menschengemachten Klimawandel, seine Propagierung der Impfpflicht während der Pandemie, sein ziemlich unbarmherziger Umgang mit den Anhängern der Alten Messe und den treuesten Dienern seines großen Vorgängers, das alles machte es mir manchmal schwer, Papst Franziskus bedingungslos zu lieben. Seinen Predigten fehlte oft die philosophische, theologische und zeitgeistkritische Tiefe, die wir bei Benedikt XVI. zu schätzen wussten, stattdessen erschienen sie so schnörkellos wie sein ganzer öffentlicher Auftritt. Selbst im T-Shirt wagte sich der 266. Nachfolger Petri, der den „Karneval“ der klerikalen Ästhetik für beendet erklärt hatte, kurz vor Ostern in den Petersdom und verwirrte damit auch einen unschuldigen kleinen Jungen, der nicht glauben konnte, gerade dem Papst begegnet zu sein. Mit solch demonstrativer Hemdsärmeligkeit polarisierte er. Sektierer erklärten ihn schon am Tag seiner Wahl zum „falschen Propheten“, Traditionalisten beteten für ein baldiges Ende dieses „unsäglichen“ Pontifikats, während die Modernisten und Reformkatholiken mehr von ihm erwarteten, als er zu geben bereit war – und ebenfalls enttäuscht wurden. So hinterlässt er eine uneinige Kirche und ebnete den Weg zu einem Konklave, das tatsächlich zur Schicksalsstunde der katholischen Kirche wird. Doch es waren Äußerlichkeiten, von denen wir alle uns ablenken ließen. Sie verwehrten uns den Blick auf das Wesentliche: auf die Erkenntnis, dass dieser Papst Franziskus sich zeitlebens bemühte, ein authentischer Verkünder des Evangeliums Jesu Christi von der Gottes- und Nächstenliebe zu sein. Er war zwar kein Konservativer, aber auch kein Modernist, sondern ein Purist. Einer, für den Taten mehr zählten als Worte und der keine Kompromisse schätzte, weder mit der Tradition noch mit dem Zeitgeist. Ein Menschenfischer, der keine Seele verloren gehen lassen wollte und der zeitlebens um die Liebe seiner Mitmenschen rang. Ein Visionär, der von einer Kirche träumte, die so arm, schnörkellos und rein wie zu Lebzeiten der Apostel sein sollte. Ein wahrer Franziskus, der den Wohlstand seines Elternhauses verließ, um als Bettelmönch auf den Straßen zu leben und die Freundschaft von Bruder Sonne, Schwester Mond, Mutter Erde und den Geschöpfen Gottes zu suchen. Ein tieffrommer Diener Jesu, dem die Volksfrömmigkeit der Einfachen stets näher war als der intellektuelle Diskurs einer verkopften Hochschultheologie oder der barocke Pomp der letzten totalitären Wahlmonarchie unseres Planeten, des Vatikanstaates. Ein Marienverehrer, der sein Pontifikat der Madonna von Fatima weihte, der vor und nach jeder Auslandsreise der Gottesmutter wie ein guter Sohn Blümchen brachte und dessen letzter Wunsch es war, in ihrer Kirche, der Basilika S. Maria Maggiore, und eben nicht im Pomp des Petersdomes bestattet zu werden. Vor allem aber war er ein Mann des Friedens und der Gerechtigkeit, ein Versöhner, der alle umarmen wollte, ob sie nun Feinde oder Freunde waren, selbst auf die Gefahr hin, dem Falschen die Hand zur Versöhnung zu reichen und von diesem vereinnahmt zu werden. Sein Evangelium war das von einem barmherzigen Gott, der jedem verzieh, seine Nächstenliebe war grenzenlos, auch wenn seine Barmherzigkeit eigene Grenzen hatte. Wenn ich die letzten zwölf Jahre mit Papst Franziskus in diesen Tagen Revue passieren lasse, dann sind es die großen Gesten und Bilder, die unvergessen blieben und mich nachhaltig berührten. An erster Stelle natürlich der Tag des Habemus Papam, als er da, ohne jeden päpstlichen Pomp, auf der Loggia des Petersdomes erschien und die Gläubigen mit einem schlichten „Buona Sera“ grüßte. Nicht mit „Laudetur Jesus Christus“, nicht mit „In nomine patris…“, sondern so, als habe er nicht die Kathedra Petri bestiegen, sondern eine römische Trattoria betreten. Statt gleich seinen ersten päpstlichen Segen zu spenden, neigte er sein Haupt und bat die Gläubigen um ihr Gebet für ihn. Eine Geste der Demut, die Herzen berührte. Zeitlebens verabschiedete er sich von jedem Audienzteilnehmer mit den Worten „Bitte beten Sie für mich!“ Nur seinen Kritikern sagte er: „Beten Sie für mich, nicht gegen mich!“ „Das mache ich ja, aber es nutzt leider nichts!“, soll einer seiner Kritiker im Kardinalsrang geantwortet haben. Daraufhin lachten beide herzlich. Selbst kleine Sticheleien raubten ihm nicht den Humor. Für uns alle, die wir damals auf dem Petersplatz standen, war dieses Habemus Papam aber schon vorher eine Überraschung gewesen. Niemand, aber wirklich kein einziger Vatikankorrespondent, dem ich in den Tagen vor und während des Konklaves begegnet war, hatte ihn auf dem Schirm gehabt. Dass Kardinal Scola Nachfolger Benedikts XVI. wird, schien ausgemachte Sache zu sein. So sicher, dass, als der weiße Rauch am 13. März aus dem Schornstein der Sixtina drang, die italienischen Bischöfe ihm bereits ein Glückwunschtelegramm schickten, wie sie später, peinlich berührt, eingestehen mussten. Wer war dieser Bergoglio? Wir wussten es nicht! Einem meiner Kollegen war das egal. Er schrieb innerhalb einer Woche eine Biografie des neuen Papstes, die zum größten Teil seiner Phantasie entsprungen war, sich aber glänzend verkaufte. Sie erzählte die Geschichte eines Proletarierpapstes, dessen bettelarme Großeltern in Argentinien ihr Glück suchten und dessen Vater ein Eisenbahnarbeiter war. Als ich ein paar Wochen später seiner Schwester Maria Elena Bergoglio davon erzählte, musste sie herzhaft lachen, denn alles war falsch. Die Großeltern waren durchaus bürgerlich und besaßen in Turin eine Konditorei, die abends auch als Bar benutzt wurde und mussten das Land nur verlassen, weil die kirchlich aktive Großmutter Bergoglio zu offen auf Mussolini geschimpft hatte. Als sie im Januar in Buenos Aires ankam, trug sie trotz des argentinischen Sommers stolz ihren Pelzmantel, in den ihre Geldscheine eingenäht waren. Dann bezogen die Bergoglios einen vierstöckigen Palazzo mit eigenem Fahrstuhl, den die Brüder des Großvaters hatten bauen lassen, als sie in Argentinien reich geworden waren. Erst die Weltwirtschaftskrise von 1929 machte dem Reichtum ein Ende und ließ die Großeltern in Buenos Aires ein Lebensmittelgeschäft eröffnen. Der Vater des Papstes, schon in Turin Bankbuchhalter, half erst seinen Eltern, dann nahm er einen Job als Buchhalter in einer Miederwarenfabrik an. So wuchs Franziskus, 1936 geboren, in einem wunderhübschen Jugendstilhaus in dem pittoresken, bürgerlichen Stadtteil Flores auf, statt in den Armensiedlungen am Stadtrand. Er studierte, wollte Chemiker werden, als der Herr ihn zum Priester berief. Der Ruf Gottes führte ihn in den Jesuitenorden, der ihn mehr als alles andere prägte. In Europa sind die Jesuiten große Intellektuelle und Pädagogen, in Lateinamerika aber Missionare und Sozialarbeiter. Letztes lag ihm dann auch mehr als das Studium der Theologie; sein Auslandsaufenthalt in Deutschland führte nicht etwa zur geplanten Dissertation, sondern eher zur Entdeckung von Land und Leuten und einer großen Liebe zur „Knotenlöserin“, einem Gnadenbild der Gottesmutter, das er in Augsburg kennenlernte. Er wurde zum Bischof der Armen und zum Gewissen der argentinischen Kirche, das durch seine Glaubwürdigkeit überzeugte. Der Schlüsselsatz, den mir Maria Elena Bergoglio mit auf den Weg gab, um Papst Franziskus zu verstehen, war, dass er einst von seinem Vater gelernt hatte, nicht durch Worte, sondern durch das eigene Beispiel zu erziehen. Und genau das tat er: er kreierte Glaubwürdigkeit! Er fuhr nicht mit der bischöflichen Limousine durch Buenos Aires, sondern benutzte die U-Bahn. Er wohnte in einem einfachen Zimmer, statt in einem erzbischöflichen Palais, und er besaß nicht einmal – für einen Kardinal höchst untypisch – eine eigene Bibliothek. Stattdessen kam er auch nach Rom nur mit einer kleinen Ledertasche und brauchte, als er Papst wurde, nichts nachkommen lassen. Ein Hotelzimmer im Domus Sanctae Marthae genügte ihm, dort konnte er zumindest den Menschen nahe sein. Denn als Ordensmann brauchte er zeitlebens die Kommunität. Er wusste, dass es wenig Sinn macht, von einer armen Kirche zu predigen, von Barmherzigkeit und Teilen, während man selbst im Palast wohnt. Dass er im Domus S. Marthae ein größeres Schlafzimmer hatte als im päpstlichen „Appartamento“, spielte dabei keine Rolle. Auch nicht, dass seine groß angekündigte Kurienreform in erster Linie aus einer Umetikettierung bestand, als aus „Kongregationen“ kurzerhand „Dikasterien“ wurden. Es ist die Wirkung nach außen, die bei den Menschen ankam. Das hat Bergoglio besser verstanden als die meisten seiner Vorgänger. Er hat ein natürliches Gefühl dafür gehabt, wie er die Menschen erreichte. Das hätten ihm hundert PR-Berater nicht besser beibringen können. Zu dieser Strategie gehörten auch medien- und öffentlichkeitswirksame „große Gesten“, die wiederum positive Schlagzeilen kreieren. Doch wer glaubte, dass es Inszenierungen waren, der irrt. Oft genug folgte Franziskus spontanen Inspirationen, vertraute er dem Heiligen Geist, was ihm unberechenbar erscheinen ließ und den Spitznamen „Spontifex Maximus“ einbrachte, zum Schrecken aller Zeremoniare und auch eines manchmal überforderten Pressebüros. Zur Ikone seines Pontifikats wurde diese Szene: Einen Monat nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa, am 27.3.2020, erflehte Papst Franziskus in einer Gebetsvigil bei strömendem Regen auf dem menschenleeren Petersplatz Gottes Trost und Beistand in der Not und spendete den Segen „Urbi et Orbi“ (siehe Foto oben). „Von diesen Kolonnaden aus, die Rom und die Welt umarmen, komme der Segen Gottes wie eine tröstende Umarmung auf euch herab", rief er, bevor er betete: „Herr, segne die Welt, schenke Gesundheit den Körpern und den Herzen Trost.“ Zum Gebet des Papstes waren zwei altehrwürdige Ikonen aus dem religiösen Leben Roms auf den Petersplatz gebracht worden, das Marienbildnis Salus Populi Romani („Heil des römischen Volkes“) sowie das Pest-Kruzifix aus der Kirche San Marcello. Zufall oder nicht – vom nächsten Tag an nahmen die Zahlen der Neuinfektionen wie der Todesfälle plötzlich ab! Auf die Syrienkrise im September 2013, als Barack Hussein Obama fast den Dritten Weltkrieg ausgelöst hatte, reagierte er mit einer Gebetsvigil; zwei Tage später war die Gefahr gebannt. Als Russland in der Ukraine einmarschierte und kurz davor stand, die Hauptstadt Kiew einzunehmen, ließ er das Gnadenbild von Fatima einfliegen und weihte beide Länder der Gottesmutter; der Vormarsch wurde gestoppt, die Souveränität der Ukraine bis heute bewahrt. Zu solchen „Zeichen und Wundern“ war Franziskus in der Lage, wenn er ganz auf Gott vertraute. Doch ganz andere Bilder, von der Amazonas-Synode 2019 samt einer eher peinlichen Huldigung an die Symbolfigur für „Mutter Erde“, Pachamama, irritierten die Gläubigen und setzten Franziskus schweren Anschuldigungen aus. Durchaus authentisch war die Sorge des argentinischen Papstes um die Benachteiligten. Zu den berührendsten Momenten seines Pontifikats gehörten seine Mittwochsaudienzen. Er erschien vom ersten Moment an auf dem Papamobil wie ein antiker Triumphator. Er liebte das Bad in der Menge und die Selfies, war bemüht, an wirklich jedem, selbst an den hintersten Reihen, vorbeizufahren. Der offizielle Teil schien ihn zu langweilen, er fieberte dem Moment entgegen, wenn er zu den Kranken und Behinderten hinabsteigen konnte und ganz für sie da war. Ohne jede Berührungsangst, liebevoll, ja zärtlich umarmt und küsste er jeden. Er hörte dort auch zu. Die prima fila dagegen schien ihn weniger zu interessieren, da schweifte sein Blick schon zum nächsten, wenn ein Audienzteilnehmer ihm noch etwas zu erzählen versuchte. Er war ganz der „Papa del popolo“, der Papst des (einfachen) Volkes, dem er natürlich ein „buon pranzo“, also „gesegnete Mahlzeit“ wünschte und dem er sich nahe fühlte. Die katholische Elite langweilte ihn. Bewundernswert war seine Fürsorge für die Obdachlosen, die bald zu Hunderten rund um den Vatikan lagerten. Seinem Almosenmeister Erzbischof Konrad Krajewski bescheinigte er, „den besten Job im Vatikan“ zu haben, was sicher ernst gemeint war. Seitdem stehen auf dem Petersplatz Toiletten und Duschen für Obdachlose zur Verfügung, zudem tägliches Mittagessen, manchmal wurden auf Einladung des Papstes auch Ausflüge organisiert. Er plädierte für soziale Verantwortung und gegen die Ellbogengesellschaft, gegen die “Vergötterung des Marktes“ und „mangelnde Gerechtigkeit“ in der westlichen Gesellschaft. Doch dabei berief der sich auf die Lehre Jesu und die Soziallehre der Kirche, nicht auf Marx. Ein Kommunist, wie ihm unterstellt wurde, war er nie, durchaus aber ein Revolutionär südamerikanischer Prägung. „Die Wahl meines Bruders ist eine echte Revolution“, versprach mir schon im Mai 2013 seine Schwester, als ich sie in Buenos Aires interviewte. Seltsam genug übrigens, dass zwölf Jahre lang kein einziger europäischer Journalist oder Franziskus-Biograf ihre Nähe suchte, dass sie erst jetzt nach dem Tod von Franziskus von den Medien entdeckt wurde. Sie hat zwar das Manko, zwölf Jahre jünger zu sein, aber sie ist doch seine einzige noch lebende Angehörige gewesen. Seine Eltern und vor allem die fromme Großmutter hatten ihm seinen tiefen Glauben vermittelt. Aber gleichermaßen prägte ihn, schon durch die Schule, die argentinische Gesellschaft, der Nationalismus eines Peron. Franziskus war, das bestätigte mir seine Schwester, Peronist. Sie hält Peronismus für eine Umsetzung der katholischen Soziallehre. Aber Peronismus ist auch die perfekte Synthese von Diktatur, Sozialismus und Show-Business, und ja, Franziskus war ein Papa peronista, in den Augen vieler seiner Anhänger ebenso wie in den Augen seiner Gegner, die ihm diktatorische Züge unterstellen, weil er auf keinen Fall entscheidungsschwach war. Doch er wurde kein Politiker, ganz bestimmt aber ein politischer Papst, nicht nur wegen Peron. Auch sein Orden, die Jesuiten, eckten von Anfang an in Südamerika an, weil sie sich auf die Seite der Armen und Unterdrückten gestellt hatten. Ein Umstand, der im 18. Jahrhundert sogar zum zeitweisen Verbot der Gesellschaft Jesu führte. Ein Pazifist war er ganz sicher: In den vielen Weltkonflikten seit Beginn seines Pontifikates, die für ihn bereits einen „dritten Weltkrieg“ darstellen, setzte er immer konsequent auf Frieden, notfalls auch mit Kompromissen. Das war im syrischen Bürgerkrieg nicht anders als im Ukraine-Konflikt, bei dem er so neutral blieb, dass beide Kriegsparteien ihm eine Nähe zur jeweils anderen Seite unterstellten. Doch bei aller Diplomatie und political correctness hatte er auch den Mut zur Aussprache unbequemer Wahrheiten. So prangerte er regelmäßig die Christenverfolgung im Nahen Osten an und war bereit, eine diplomatische Krise mit der Türkei in Kauf zu nehmen, als er den Völkermord an den Armeniern 1915 auch tatsächlich einen solchen nannte. Ein weiterer Schwerpunkt seines Pontifikats war der interkonfessionelle und interreligiöse Dialog. Mit Bartholomäus, dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, verband ihn eine enge Freundschaft, ebenso wie mit dem koptischen Papst Tawadros, mit dem er 2019 sogar eine gemeinsame Audienz im Vatikan abhielt. Er konnte nicht ahnen, wie verheerend sich das Dokument „Fiducia Supplicans“ seines neuen Präfekten des Glaubensdikasteriums, des liberalen Argentiniers Kardinal Fernandez, auf den Dialog mit den Ostkirchen auswirken würde, für die jede noch so unsakramentale Homo-Segnung ein Unding ist. Intensiv verlief auch der Dialog mit den Lutheranern, noch näher stand er den evangelikalen Christen. Exzellent war sein Verhältnis zum Judentum - schon in Buenos Aires war Rabbi Abraham Skorka, mit dem er ein Buch herausgab, einer seiner engsten Freunde – aber auch zum Islam. Auf seine Israel-Reise nahm er den muslimischen Imam von Buenos Aires mit, in Kairo intensivierte er den Dialog mit der al-Azhar-Universität, dem theologischen Zentrum der islamischen Welt. 2019 unterzeichneten der Papst und Ahmad al-Tayyib, der Scheich der Azhar, gemeinsam in Abu Dhabi das Dokument „Über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt“, was auch zum Thema seiner Enzyklika „Fratelli tutti“ wurde. Geschlossene Grenzen, wie sie etwa US-Präsident Donald Trump fordert, lehnte er ab, bis hin zu dem historisch ziemlich fragwürdigen Statement, „Christen bauen keine Mauern“. Das große Thema seines Pontifikats aber war Gottes Barmherzigkeit. Kein neues Thema, schon Johannes Paul II. schrieb 1980 die Enzyklika „Dives in misericordia“ („Über die göttliche Barmherzigkeit“), die wegweisend war. Franziskus, der nie ein großer Theologe war, wurde damit auf dem Konklave konfrontiert, als ihn der deutsche Theologe Kardinal Walter Kasper sein Buch „Barmherzigkeit“ schenkte. Es sprach den Papst so sehr an, dass Kasper fortan sein „Leib- und Magentheologe“ wurde. Kaspers Theologie dominierte dann auch die Familiensynode 2014/15, die in der Veröffentlichung des „nachsynodalen apostolischen Schreibens“ „Amoris laetitia“ gipfelte, zu dessen wichtigsten Autoren der Wiener Erzbischof em. Christoph Kardinal Schönborn gehörte. Eine Fußnote in A.L., die „in gewissen Fällen“ auch wiederverheirateten Geschiedenen „die Hilfe der Sakramente“ zubilligte, war so offen gehalten (und führte zu den unterschiedlichsten Auslegungen), dass vier Kardinäle ihren Klärungsbedarf anmeldeten, um ein de facto Schisma in dieser Frage zu vermeiden. Franziskus antwortete nicht, denn das hätte eine Festlegung bedeuten. Er wollte lieber „nach allen Seiten hin offen“ bleiben und niemanden enttäuschen, niemandem vor den Kopf stoßen und für die Kirche verlieren. Seelenfischen war ihm stets wichtiger als Lehramtstreue. Stattdessen feierte die Kirche 2015/16 als „Außerordentliches Heiliges Jahr der Barmherzigkeit“; es sollte der Höhepunkt des Bergoglio-Pontifikates werden, in dem er sich als „Papst der Barmherzigkeit“ präsentieren konnte. Das nächste „reguläre“ Heilige Jahr, 2025, wurde eher lieblos vorbereitet und litt dann auch unter dem wochenlangen krankheitsbedingten Ausfall des Papstes. Immer wieder demonstrierte Franziskus seine Bereitschaft, den Sünder in seine Arme zu schließen, auch wenn er durchaus klare Standpunkte vertrat. Bei aller Toleranz, bei allem „Who am I to judge“, hat er doch deutlich für den Lebensschutz, gegen Abtreibung, die Homo-„Ehe“ und die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare Stellung bezogen. Wer daher Franziskus für einen Modernisten hält, der sei daran erinnert, dass kein Papst der Moderne so oft ganz unverblümt über den Teufel gesprochen hat wie er. Dass er falsch verstanden wurde, dass man schon früh versuchte, ihn für die Sache der Kirchenreformer einzuspannen, wurde ihm oft genug zum Verhängnis. In Deutschland fühlte man sich zu einem waghalsigen „Synodalen Weg“ veranlasst, mit irrwitzigen Forderungen an die Weltkirche, die schon an ihrer Absurdität und konsequenten Verneinung der kirchlichen Lehre scheitern mussten, weil man dem Zerrbild glaubte, das skrupellose Journalisten von ihm zeichneten. „Der Papst ist mit uns!“, versuchte ein Bischof Bätzing den Synodalen weißzumachen. Und erlitt einen fatalen Schiffbruch und Vertrauensverlust, als Franziskus dann doch nicht bereit war, nach der Pfeife der Deutschen zu tanzen. So wird er wohl als missverstandener Papst in die Geschichte eingehen und die Tragik bleiben, dass diese Missverständnisse die Gläubigen polarisierten und nicht selten auch von ihrem Oberhirten entfremdeten. Was aber bleibt ist die Erinnerung an einen Papst, der zutiefst menschlich war. Der die Menschen liebte, so bedingungslos, wie es Gott von uns erwartet, und der eine Kirche wollte, die keinen alleine lässt. So wurden seine letzten Tage vielleicht zum stärksten Zeichen seines Pontifikats. Sein unbedingter Wille, zu Ostern, am höchsten Fest der Christenheit, auch als alter, müder, von Krankheit und dem nahenden Tod gezeichneter Hirte noch einmal bei seiner Herde zu sein, sie mit einem zutiefst menschlichen „Frohe Ostern!“ zu grüßen und auf die schlichtest mögliche Weise zu segnen. Und dann nahm er ein letztes Bad in der Menge. Die letzten Worte eines Papstes haben immer etwas Prophetisches. Der nahezu verklärte Benedikt XVI. starb mit den Worten „Jesus, ich liebe Dich“ auf den Lippen, der große Johannes Paul II. mit „Lasst mich ins Haus des Vaters gehen.“ Bei Franziskus lauteten sie, an seinen Krankenpfleger gerichtet: „Danke, dass sie mich zurück auf den Platz gebracht haben.“ Denn nur das war ihm wichtig: Bei den Menschen zu sein, für sie da zu sein. Er war wahrhaft der „Papa del popolo“, der Volkspapst! Sein Buch „Hoffe“, das nur wenige Monate vor seinem Tod erschien, ist großartig und schon jetzt ein spiritueller Klassiker. Doch die Welt wird sich auf andere Weise an Franziskus erinnern. Wenn immer wir einem Obdachlosen, einem Bettler, einem Flüchtling, einem Ausgestoßenen begegnen, sollten wir uns fragen: Wie wäre Papst Franziskus mit ihm umgegangen? Die Worte Jesu „Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25.40) sind durch ihn wieder aktuell geworden. So rief uns dieser unbequeme Mann aus Argentinien wie kein anderer zu Nächstenliebe und Christusnachfolge auf. Und das allein macht ihn schon zu einem großen Papst, der Zeichen gesetzt hat. Sein Beispiel kann uns alle zu besseren Menschen und die Welt zu einem gerechteren Ort machen – und damit dem Himmel ein wenig näher bringen. Danke, Papst Franziskus! VIDEO-Zusammenfassung: Der Segen Urbi et Orbi von Papst Franziskus in der Corona-Pandemie: Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  Lesermeinungen
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu | 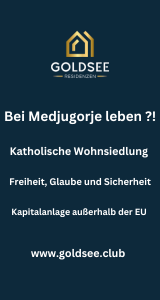      Top-15meist-gelesen
| |||||||||||
 | ||||||||||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||||||||||

